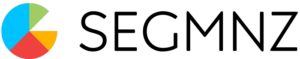Wenn ein Satz wie ein Zündfunke wirkt:
„ Bei der Migration sind wir sehr weit …wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem …“
Friederich Merz, Kanzler der Bunderepublik Deutschland
Ein Satz, gesprochen von Bundeskanzler Friedrich Merz am 14. Oktober 2025, der sich seitdem durch Talkshows, Kommentarspalten und WhatsApp-Gruppen zieht wie ein Lauffeuer. Es ist einer dieser Sätze, bei denen man nicht weiß: Ist das schon Kalkül – oder einfach bloß unsensibel? Die einen jubeln: Endlich sagt es mal einer. Die anderen sind fassungslos: So spricht ein Kanzler?
Doch statt uns in die Empörungslogik der Stunde zu verstricken, lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten: Was sagt dieser Satz über unsere Stadtbilder – und über unser gesellschaftliches Klima? Und warum triggert er gerade so viele Menschen – in ganz unterschiedlichen Motivationslagen?
Zwischen Gefühl und Gestaltungsauftrag: Stadtbild als Projektionsfläche
Was meinen wir eigentlich, wenn wir vom Stadtbild sprechen?
Geht es um architektonische Ästhetik? Sauberkeit? Wer wo sitzt, steht oder bettelt? Oder geht es – wie so oft – um viel mehr: um Identität, um Sichtbarkeit, um Zugehörigkeit?
Stadtbilder sind keine neutralen Kulissen. Sie sind Spiegel gesellschaftlicher Dynamiken – und immer auch umkämpfte Räume. Was als „störend“ empfunden wird, hängt oft weniger mit Fakten als mit inneren Bildern zusammen: von Ordnung, Kontrolle, Zugehörigkeit. Und genau da wird es politisch.
Wenn Sprache aufgeladen ist
Sprache ist nie nur Sprache. Sie ist Handlung. Wenn ein Kanzler sagt, wir hätten ein Problem im Stadtbild, spricht er nicht über Laternen und Häuserfassaden. Er spielt auf Menschen an – auf ihre Präsenz im öffentlichen Raum. Und diese Menschen sind nicht „das Stadtbild“. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Sichtbar. Vielleicht unbequem. Aber existent.
Diese Formulierung rückt Menschen in die Nähe eines ästhetischen Störfaktors – als wäre der öffentliche Raum ein Schaufenster, das ordentlich bestückt sein muss. Dabei ist das Stadtbild Ausdruck dessen, was wir als Gesellschaft aushalten, gestalten und verändern wollen.
Wer sich von der Stadt abwendet, wendet sich auch von ihren Menschen ab
Es ist leicht, sich über „Unordnung“ zu beklagen – über Lärm, Müll, Provisorien. Schwieriger ist es, die Ursachen zu benennen: Wohnungsmangel, prekäre Beschäftigung, Migration ohne Plan, Politik ohne Verlässlichkeit. Diese Probleme lassen sich nicht durch „Genervtsein“ lösen, sondern nur durch politische Gestaltung.
Und: Wer das Stadtbild als Problem markiert, riskiert, Menschen pauschal abzuwerten, deren Lebensrealität oft gar nicht gesehen wird – und die weder Ursache noch Lösung der Missstände sind.
Der eigentliche Punkt: Was für eine Gesellschaft wollen wir sein?
Der Satz des Kanzlers bringt etwas ans Licht, das längst im Raum steht: Ein wachsendes Unbehagen an der Veränderung. Unsere Städte sind nicht mehr homogen, nicht mehr geordnet nach alten Mustern. Sie sind vielfältig, komplex, manchmal auch überfordert. Aber sie sind real – und sie erzählen Geschichten von Migration, Wandel, Teilhabe und Ausgrenzung.
Statt sich genervt abzuwenden, braucht es politische Verantwortung, die sich zuwendet:
- Den sozialen Ursachen von Obdachlosigkeit
- Den Herausforderungen von Integration
- Der Frage nach gerechter Stadtplanung
Denn ein „gutes“ Stadtbild ist nicht eins, das stört, sondern eines, das trägt.
Und was hat das mit Motivation zu tun?
Wer verstehen will, warum dieser Satz so polarisiert, sollte auf die Handlungsmotivationen schauen, die in unserer Gesellschaft wirken:
- Zweckrationale (TYP-Z) Menschen fragen: „Wie kriegen wir das in den Griff?“ Sie wollen Lösungen, Ordnung, Steuerbarkeit.
- Werterationale (TYP-W) reagieren auf moralische Verletzung: „So spricht man nicht über Menschen.“
- Affektuell Motivierte (TYP-A) fühlen sich emotional berührt – entweder im Zorn oder in der Betroffenheit.
- Traditionelle Typen (TYP-T) spüren den Verlust gewohnter Ordnung: „So war das früher nicht.“
Ein einziger Satz – vier unterschiedliche Reaktionen. Das zeigt: Kommunikation muss sich an Motivation orientieren.
Fazit: Wir brauchen mehr Klartext – aber nicht weniger Verantwortung
Ja, man darf unzufrieden sein mit der Lage in unseren Städten. Und ja, politische Kommunikation darf klar sein. Klar heißt hier aber nicht bloß laut, sondern zugeschnitten auf die unterschiedichen Motivations-Typen der Gesellschaft. Wer über das Stadtbild spricht, sollte nicht über Menschen hinwegreden.
Wer regiert, muss gestalten – nicht stigmatisieren.
Und wer Veränderung will, braucht Verständnis für die Motivationsagen aller in einer komplexen Gesellschaft.